Weg von der Strasse, zurück zur Familie
Dank dem Projekt «Second Chance» sollen Menschen mit psychischen Behinderungen, die in der Region Nord in Burkina Faso auf der Strasse leben, in einem Zentrum stabilisiert und dann in ihre Familien und die Gesellschaft reintegriert werden. Geführt wird das Projekt von der CBM-Partnerorganisation «Sauvons le Reste» (SAULER), die mit zahlreichen Freiwilligen aufsuchende Sozialarbeit betreibt. Ein Gespräch mit Adama Ouedraogo, Mitbegründer und Präsident von SAULER.
Woher kam Ihre Motivation, ein solches Projekt zu initiieren?
Ich hatte hier in Ouahigouya einst ein einprägendes Erlebnis: Ich lief der Strasse entlang und wollte Essen kaufen. Plötzlich stolperte ich über eine am Boden liegende Frau, die ich nicht gesehen hatte. Zunächst ging ich ein Stück weiter, doch dann kehrte ich wieder zu ihr zurück und sagte ihr, sie solle doch in den Schatten gehen. Es war sehr heiss an jenem Tag. Sie jedoch wollte lieber etwas zu essen. So besorgte ich ihr Essen und Wasser, gab es ihr und sie setzte sich danach in den Schatten. Die Frau war jedoch gesundheitlich so angeschlagen, dass ich sie zu einer Gesundheitsstation brachte, wo man sie behandelte. Ab diesem Zeitpunkt war mir klar: Ich möchte etwas für obdachlose Menschen tun. Diese Personen erhalten in Burkina Faso keine ausreichende Hilfe erhalten, weder vom Staat noch von der Gemeinschaft. Sie werden abgelehnt und führen ein Leben unter sehr schwierigen Umständen. Ich wollte dazu beitragen, dass sich die Lebensumstände dieser Menschen verbessern.
Was geschah danach?
2011 habe ich mit einigen anderen Personen mit ersten Aktivitäten begonnen. Jedoch hatten wir damals noch keine offizielle Anerkennung. Wir haben auf den Strassen von Ouahigouya nach Obdachlosen Ausschau gehalten und sie rasiert oder ihnen die Haare geschnitten. Jedoch konnten wir ihnen keine neuen Kleider geben, sie auch nicht waschen oder ihnen Essen geben. 2012 dann erhielten wir von den Behörden die offizielle Anerkennung. Danach konnten wir zum Beispiel das übriggebliebene Essen in Restaurants mitnehmen und es an obdachlose Menschen weitergeben. Wir bauten unsere Aktivitäten immer mehr aus. Letzter Höhepunkt war die Fertigstellung unseres Zentrums im vergangenen Jahr.
Wie finden Sie Menschen mit psychischen Behinderungen und wie geht es dann weiter mit ihnen?
Jeweils am Donnerstag und Sonntag machen wir eine Tour, bei der wir gezielt nach Menschen mit psychischen Behinderungen suchen, die in der Region Nord auf der Strasse leben. An jenen Tagen können sie auch zu uns in das Zentrum kommen, um sich zu waschen und wir geben ihnen etwas zu essen. Zudem erhalten wir auch Hinweise, meist von Familienangehörigen, dass es in ihrer Familie eine Person mit einer psychischen Behinderung gibt. Vielfach sind diese Personen angekettet, zum Teil während mehreren Jahren. Wir nehmen die Person in unsere Obhut und bringen sie zunächst in die psychiatrische Abteilung des regionalen Universitätsspitals. Parallel dazu informieren wir die Familie über das gesamte Vorgehen und sensibilisieren über das Thema psychische Behinderung. Danach kehren die Patientinnen und Patienten zu uns in das Zentrum zurück und bleiben bei uns, bis sich ihr Zustand stabilisiert hat und sie in ihre Familien zurückkehren können. Generell arbeiten wir eng mit anderen Akteuren zusammen und fungieren als Relaisstelle zwischen den Patientinnen und Patienten sowie den anderen Institutionen. Wir überwachen auch die Einnahme der Medikamente, die wir von der psychiatrischen Abteilung des Universitätsspitals erhalten.
Was können Sie über die Patienten hier im Zentrum sagen?
Wir treffen auf Menschen mit vielen verschiedenen psychischen Behinderungen: Depressionen, Epilepsie und auch Menschen, die Drogen konsumiert haben und dadurch psychisch erkrankt sind. Besonders in den Goldminen, von denen in den vergangenen Jahren im Norden Burkina Fasos viele eröffnet wurden, greifen viele Menschen zu Drogen und Aufputschmitteln, um die unmenschlichen Arbeitsbedingungen durchzustehen. Diese Substanzen können psychische Behinderungen auslösen und stark abhängig machen. Das steigert auch die Gefahr, auf der Strasse zu landen. In jenen Minen arbeiten vor allem Männer. Dies ist der Grund, weshalb wir hier im Zentrum so viele Männer haben.
Was sind Herausforderungen, denen Sie heute begegnen?
Zum einen ist da die vorherrschende Mentalität der Gesellschaft. Menschen mit psychischen Behinderungen werden stark stigmatisiert. Durch das Projekt und Kampagnen können wir die Bevölkerung in der Region um Ouahigouya aufklären, was psychische Behinderungen genau sind und wie die Gesellschaft und die betroffenen Familien Angehörige mit psychischen Behinderungen unterstützen können. Denn die Familien sind aufgrund des fehlenden Wissens häufig überfordert. Wir müssen deshalb die Sensibilisierung für dieses Thema vorantreiben – sei es bei den Behörden, der Gesellschaft oder den Familien.
Was machen Sie diesbezüglich konkret?
Wir führen verschiedene Sensibilisierungsmassnahmen durch: das Theaterforum, Hausbesuche, Radiosendungen und die Zusammenarbeit mit Opinion Leaders. Gerade das Theaterforum ist eine gute Methode, das Thema psychische Behinderungen mit all seinen Implikationen auf leicht verständliche Art und Weise zu veranschaulichen. Wir spielen Alltagssituationen nach, die für Menschen mit psychischen Behinderungen und deren Familien typisch sind und tragen dadurch zur Aufklärung der Bevölkerung bei. Beim Radio machen auch Menschen mit, die mal im Zentrum waren und nun wieder stabilisiert und bei ihren Familien sind. Sie erzählen dann von ihren Erfahrungen. Hörerinnen und Hörer haben auch die Möglichkeit in der Sendung anzurufen und Fragen zu stellen, die von Spezialisten beantwortet werden.
Was geschieht, wenn die Personen wieder in ihren Familien integriert sind? Gibt es eine Art Nachbehandlung?
Ja, wir besuchen die Personen, die wieder in die Familien zurückgekehrt sind. Wir führen Krankenakten bei uns und rufen zum gegebenen Zeitpunkt die Familien an, um unseren Besuch anzukündigen. Bei den Besuchen schauen wir, wie es den Personen geht. Wir besprechen die Medikation und organisieren, falls nötig, auch finanzielle Unterstützung.
Gibt es viele Probleme mit Familien?
Nein überhaupt nicht, und wenn, dann am Anfang. In solchen Fällen kontaktieren wir das Ministerium für soziale Angelegenheiten. Sie nehmen Kontakt mit der Familie auf und versuchen, das Problem zu lösen. Die meisten problematischen Fälle geschehen dann, wenn die Eltern oder enge Angehörige der betroffenen Person nicht mehr leben und sich die erweiterte Familie der stabilisierten Person annimmt. Das Ministerium für soziale Angelegenheiten ist es auch, das zusammen mit der psychiatrischen Abteilung des regionalen Universitätsspitals entscheidet, ob der Patient soweit stabilisiert ist, damit er das Zentrum verlassen und zu seiner Familie zurückkehren kann. Sofern der Patient das wünscht.
Gab es schon Fälle, in denen jemand nicht in die Familie zurück wollte?
Nein, das gab es bislang noch nie. Es gibt aber Fälle, in denen es schwierig ist, die Familien zu finden. Bis die Familien gefunden werden, bleiben die Personen hier im Zentrum. Wir möchten sie auf keinen Fall zurück auf die Strasse schicken. Und es gibt Fälle, in denen die Familie gar nicht gefunden wird. Hier wird geschaut, dass die Personen, abgestimmt auf ihre Fähigkeiten, beruflich integriert werden können. Andere beginnen auch, bei uns im Zentrum zu arbeiten.
Wie hoch ist die Kapazität im Zentrum?
Es gibt 24 Betten für Männer und 16 Betten für Frauen, sie schlafen in getrennten Räumen. Für weitere Personen haben wir Matten gekauft. Es gibt Familien, die mit Angehörigen mit psychischen Behinderungen zu uns kommen. Es kommt vor, dass wir sie aus Kapazitätsgründen nicht aufnehmen können. Die Familien kehren dann zurück und lassen ihre Angehörigen auf der Strasse zurück – in der Hoffnung, dass wir sie dann finden und aufnehmen. Wir versuchen jedoch stets, so viele wie nur möglich aufzunehmen. Vor allem diejenigen, die von weit kommen und keine Familie haben. Es kommen immer mehr Menschen, die aus anderen Regionen Burkina Fasos oder gar aus den umliegenden Ländern stammen. Unser Projekt wird immer bekannter.
Haben Sie eine Vision oder einen Wunsch für die Zukunft?
Ja! Alle Menschen im Norden von Burkina Faso, die mit psychischen Behinderungen auf der Strasse leben, sollen die Betreuung erhalten, die sie brauchen. Um das erreichen zu können, wollen wir die Aktivitäten von SAULER ausweiten und diese auch in andere Regionen hinaustragen. Und wir möchten mehr Sensibilisierungsarbeit leisten: Die Bevölkerung soll erkennen, dass es auch an uns, der Gesellschaft, liegt, Menschen mit psychischen Behinderungen zu unterstützen. Denn heute werden sie noch sehr stark stigmatisiert, schlecht behandelt und stark ausgegrenzt. Familien, die Angehörige mit Menschen mit psychischen Behinderungen haben, sollten stärker unterstützt werden. Sie werden heute gänzlich sich selbst überlassen. In meiner Vision gibt es keine obdachlosen Menschen mehr hier in der Region Nord von Burkina Faso.
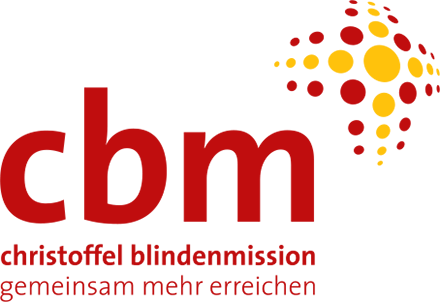

Inhalt teilen
Inhalt drucken
Seite drucken